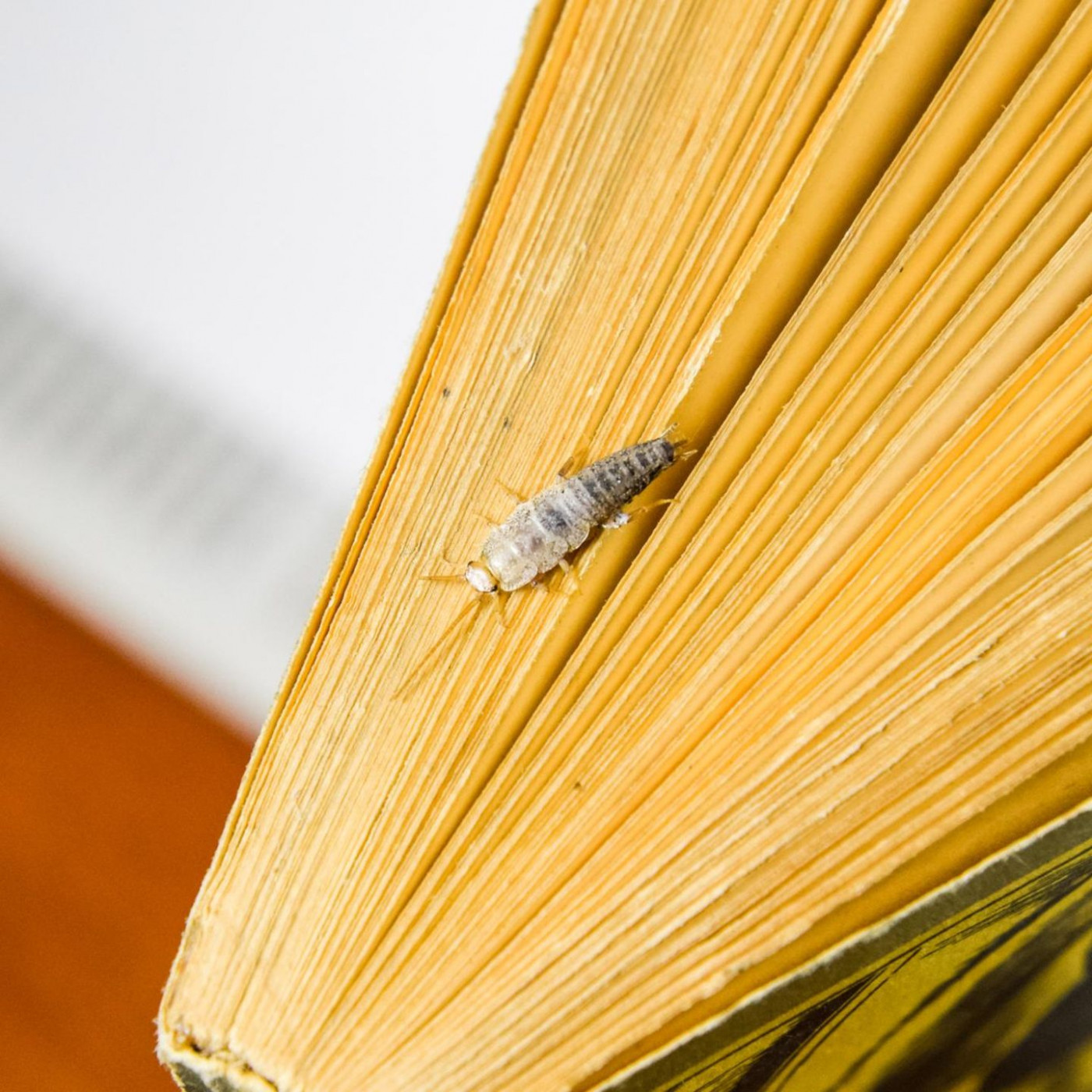Ziele werden "krachend verfehlt"
Grüner Wasserstoff gilt als ein Schlüssel zur Klimaneutralität, doch Deutschlands Pläne geraten ins Wanken. Milliardenprojekte werden gestoppt, die Industrie wartet auf Klarheit. Was müsste jetzt passieren?
Das Gelände des ehemaligen Kraftwerks Thierbach im Süden von Leipzig wirkt wie eine Maßnahme zur Renaturierung. Wo mehr als 30 Jahre lang Braunkohle verstromt wurde, wächst Gras. Im morgendlichen Nebel steigen vereinzelt Vögel auf. Eine leicht zugewachsene Infotafel erinnert noch an ehrgeizige Pläne zur wirtschaftlichen Transformation.
Der Standort sei in einer "Sinnkrise", sagt Oliver Urban, Oberbürgermeister der nahegelegenen Stadt Borna. Früher sei die Region ein großer Wirtschaftsstandort gewesen. "150 Jahre Bergbaugeschichte sind zu Ende, ein Strich, alle arbeitslos."
Im ehemaligen Kohle-Tagebaugebiet sollte deswegen auf grünen Wasserstoff gesetzt werden, als Energieträger der Zukunft. Doch diese Zukunft kommt vorerst nicht nach Thierbach. Das Unternehmen HH2E sollte auf dem Gelände eines der größten Wasserstoffkraftwerke Deutschlands bauen. Doch es ist insolvent - und kein Einzelfall. Thierbach steht nahezu idealtypisch für die aktuelle Situation des grünen Wasserstoffs in Deutschland.
Zu schön, um wahr zu sein?
Grüner Wasserstoff wird per Elektrolyse produziert. Mithilfe von Strom aus Erneuerbaren Energien wird Wasser in seine elementaren Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Der Sauerstoff wird in die Umgebung abgeleitet, der Wasserstoff aufgefangen. Im Gegensatz zu anderen nachhaltigen Energieformen wie Wind oder Solar kann dieser Wasserstoff besser gespeichert werden, wodurch er zeitunabhängig zur Verfügung steht. Bei der Verbrennung von Wasserstoff wird kein CO2 freigesetzt - ein großer Vorteil zum Beispiel für die Transformation der energieintensiven Schwerindustrie oder den Flugverkehr.
Ehrgeizige Ziele
Kein Wunder also, dass die vorherigen Regierungen beim Errechnen ihrer Klimabilanzen gern auf grünen Wasserstoff setzten. Im Sommer 2020 wurde noch unter Angela Merkel die Erste Nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet. Spätestens während der Ampel-Regierung mit Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaschutzminister erfuhr die Technologie einen Hype mit Förderungen in Milliardenhöhe, teils ungeachtet des eigentlichen Entwicklungsstands der neuen Technologie.
Bis 2030 sollten in Deutschland insgesamt zehn Gigawatt Produktionsleistung installiert sein. Doch aktuell sind deutschlandweit gerade einmal 1,6 Prozent dieses Ziels umgesetzt. Der Ausblick ist eher düster, es häufen sich die Projekte, die pausiert oder gar ganz abgesagt werden. Nur 200 Megawatt weitere Produktionsleistung sind derzeit im Bau. "Die Ziele für den Wasserstoffhochlauf im Jahr 2030 werden krachend verfehlt", sagt der Kommissarische Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats, Felix Matthes.
"Sehr viel teurer" als erwartet
Dass der Wasserstoffhochlauf in Deutschland derart stockt, liegt an verschiedenen, durchaus komplexen Faktoren. Die neue Technologie muss sich als Energieträger erst am Markt etablieren. Dafür muss ein gesamter Wirtschaftskreislauf mit Produktionsstätten, einer Pipeline-Infrastruktur zur Verteilung und mit Verbrauchern in der Industrie von Grund auf hochgefahren werden. All das braucht vor allem Geld und Planbarkeit. Doch genau das sind die zentralen Probleme.
Matthes zufolge ist der grüne Wasserstoff "sehr viel teurer" als in den Prognosen angenommen. Zugleich seien mit dem vorzeitigen Scheitern der Ampelregierung Fördermittel weggebrochen oder gar nicht erst genehmigt worden, die die Kostenlücke hätten schließen sollen. Habecks Gesetzesentwürfe kamen nicht mehr zur Abstimmung.
Das Henne-Ei-Problem
Dieses Dilemma wirkt sich auf alle Teile des Kreislaufes aus und führt zu einem klassischen Henne-Ei-Problem: Durch die Mehrkosten ist der grüne Wasserstoff für industrielle Großverbraucher aktuell unwirtschaftlich. Sogar Umstellungspläne wie bei den Stahlwerken von ArcelorMittal in Bremen und Eisenhüttenstadt werden zurückgezogen, trotz zugesicherter Fördermittel in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.
Ohne feste Abnehmer zögern potenzielle Wasserstoffproduzenten wie die mitteldeutschen Energiekonzerne EnviaM, Mibrag und LEAG mit dem Aufbau von Standorten. Wird weniger grüner Wasserstoff produziert, bleibt der Preis hoch. Nach Ansicht vieler Beteiligter müsste diese Unsicherheit politisch abgefangen werden.
Scheitern der Ampel als Unsicherheitsfaktor
Während der Amtszeit der Ampelregierung sei die Marschrichtung noch recht klar gewesen: Deutschland solle möglichst schnell klimaneutral werden und setze dabei auf grünen Wasserstoff als "Universallösung", beschreibt Falko Ueckerdt vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Die Kosten: erstmal zweitrangig. So sei ein umfassender Hype um Wasserstoff entstanden, teilweise ohne klare Priorisierung.
Mit dem Scheitern der Ampelregierung im Herbst 2024 bahnte sich ein Kurswechsel in der Energiepolitik an, der für Unsicherheit sorgt. Als Reaktion zog sich zum Beispiel die Foresight-Group als Investor bei HH2E zurück. Es war der Moment, der die ambitionierten Träume auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände in Thierbach platzen ließ.
Fehlender Überblick
Wie viele Wasserstoffprojekte in Deutschland zurückgezogen oder abgesagt wurden, lässt sich kaum überblicken. Gleiches gilt für die Kosten. Die Bundesregierung fördert den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft mit drei Einzelplänen, insgesamt 28 Titeln und 45 Programmen und/oder Einzelmaßnahmen.
Die Elektrolyse-Projekte zur Wasserstoffproduktion sind zwar als Wasserstoff-Kompass öffentlich einsehbar, doch dieser beinhalte teils auch sehr alte Projekte, die nicht mal in die Planung gegangen seien, teilt zum Beispiel das Unternehmen Enertrag mit, das verschiedene Produktionsstätten errichten will. Anscheinend sei "jede Ankündigung zur Prüfung eines Standortes schon als Projekt aufgenommen" worden. Welche dieser Prüfungen schließlich erfolglos blieben oder abgebrochen wurden, lässt sich nur in Einzelfällen herausfinden, da keine Meldepflicht bei den Ländern bestehe.
Bundesregierung will auch auf Wasserstoff aus Erdgas setzen
Wenig Klarheit herrscht auch beim zuständigen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE). Ministerin Katherina Reiche war ab der Gründung des Nationalen Wasserstoffrats selbst Vorsitzende, bis sie ins Kabinett berufen wurde.
Auf Nachfrage teilt ihr Ministerium mit, dass der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft "beschleunigt und pragmatischer ausgestaltet" werden solle. Dabei will die Regierung "alle Farben" nutzen - neben dem CO2-neutralen grünen Wasserstoff also auch blauen oder grauen Wasserstoff aus Erdgas. Bei dessen Produktion entsteht CO2, das entweder an die Umwelt abgegeben oder im Boden verpresst wird.
Dazu soll bis 2032 ein bundesweites Wasserstoff-Kernnetz aufgebaut werden. Der derzeitige Stand des Wasserstoff-Hochlaufs werde außerdem gerade durch ein Monitoring überprüft. Zu konkreten Fördersummen und -plänen gab es auf mehrfache Anfragen hin keine Antwort, auch ein Interview wurde abgelehnt.
Klimaschutzziele gefährdet?
Der Kommissarische Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats, Matthes, kann den Kurswechsel der neuen Bundesregierung zumindest teilweise verstehen. Wie bei anderen Technologien brauche es auch beim Wasserstoff "Übergangsprozesse" statt "von null auf einen weitgehend perfekten Zustand zu springen".
Falko Ueckerdt vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung befürchtet hingegen, dass aufgrund fehlenden politischen Durchhaltevermögens und zu geringer Fördergelder die Klimaschutzziele gefährdet werden.
Hoffen auf neuen Investor
Für das ehemalige Kraftwerksgelände in Thierbach gibt Oberbürgermeister Urban die Hoffnung noch nicht auf: Wenn irgendwo grüner Wasserstoff produziert werden könne, dann müsse es an dieser Stelle sein. Die Genehmigung sei da. Der derzeit größte Solarpark Europas ist nur wenige Kilometer entfernt und könnte grünen Strom liefern. Es fehle eben nur das Geld, so Urban. Deswegen hoffen er und die gesamte Region nun auf einen neuen Investor und einen Wirtschaftskreislauf, der aufgeht.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke