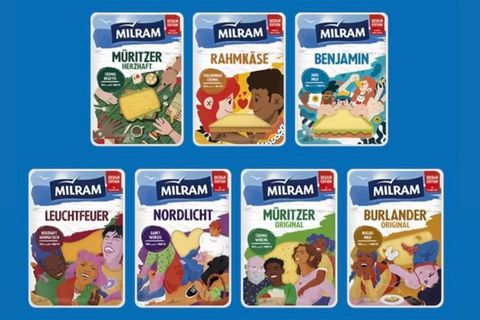Trumps Intel-Einstieg ist ein vergiftetes Geschenk
Die US-Regierung steigt bei Intel ein. Donald Trump treibt damit seine "America First"-Agenda voran und der angeschlagene Chiphersteller erhält eine dringend benötigte Finanzspritze. Doch die Rettung könnte zugleich der Anfang vom Ende sein.
Und wieder sorgt Donald Trump mit einer Volte für Schlagzeilen. Noch vor zehn Tagen hatte der US-Präsident den Rücktritt von Lip-Bu Tan gefordert, kurze Zeit später überschüttet er den in Ungnade gefallenen Intel-Chef plötzlich mit Lob. Und machte Planspiele publik, denen zufolge die US-Regierung als Nächstes einen 10-prozentigen Anteil am angeschlagenen Chiphersteller übernehmen könnte.
In einem Interview mit dem US-Sender CNBC bestätigt sein Handelsminister Howard Lutnick entsprechende Pläne jetzt. "Wir sollten für unser Geld eine Beteiligung erhalten, daher werden wir die bereits unter der Biden-Regierung zugesagten Mittel bereitstellen", sagte Lutnick im Gespräch mit CNBC. "Im Gegenzug erhalten wir Anteile", fügte er hinzu, "und erzielen eine gute Rendite für den amerikanischen Steuerzahler." Lutnick fügte hinzu, dass die US-Regierung mit der Investition keine Stimmrechte oder Rechte zur Leitung des Unternehmens erhalten würde. Lutnick gab nicht genau an, wie hoch die Investition der Regierung in Intel sein würde, widersprach jedoch nicht den jüngsten Berichten, wonach sie sich auf etwa 10 Prozent des Unternehmens belaufen würde.
Der Einstieg reiht sich nahtlos in Trumps "America First"-Agenda ein. Der Präsident drängt auf die technologische Souveränität der USA - insbesondere im Bereich der Halbleiter, die für die nationale Sicherheit und die globale Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Derzeit wird der Großteil der weltweit modernsten Chips in Taiwan produziert, das sich in einem geopolitischen Brennpunkt befindet und zunehmend in den Fokus der Spannungen zwischen den USA und China gerät. Sollte es zu einem Konflikt kommen, könnten amerikanische Unternehmen wie Apple und Nvidia, die auf diese Chips angewiesen sind, in massive Schwierigkeiten geraten.
Trotz seiner Probleme – kein Geld und keine Strategie – ist Intel der einzige US-Hersteller, der hochmoderne Chips produzieren kann. Ein Einstieg der US-Regierung scheint somit "eine geopolitische Entscheidung zu sein, um sich zu wappnen und insbesondere die Lieferketten bei den Chips sicherzustellen", sagt Ascan Iredi, Leiter des Portfoliomanagements Plutos Vermögensverwaltung im ntv-Interview. "Die Asiaten werden bei der Produktion immer besser - und Intel schwächelt."
Auch für Intel hat ein Deal mit der US-Regierung kurzfristig Vorteile. Die Trump-Administration will staatliche Zuschüsse aus dem Chips-Act ganz oder teilweise in Eigenkapital umwandeln und dem Krisenkonzern bereitstellen. Die Rede ist von insgesamt 10,9 Milliarden US-Dollar an Zuschüssen für die kommerzielle und militärische Produktion. "Anstatt einfach nur Zuschüsse zu vergeben", sagte Lutnick, sei der Präsident der Meinung, dass die Regierung "Vorteile für die Wirtschaft erzielen sollte, die wir fördern".
Intel hat wichtige Trends verschlafen
Zusammen mit einer Milliarden-Geldspitze vom japanischen Tech-Investor Softbank soll es den angeschlagenen Chipkonzern finanziell wieder auf die Beine stellen. Intel kämpft mit einem Verlust von 2,9 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal und einem Aktienkurs, der seit Anfang letzten Jahres um mehr als die Hälfte gefallen ist.
Der US-Konzern aus dem Silicon Valley hat nach dem Smartphone auch den Trend zur Künstlichen Intelligenz (KI) verschlafen und keine konkurrenzfähigen Prozessoren für diese Technologie im Programm. Bei der Fertigung hochmoderner Chips hinkt er dem weltgrößten Auftragsfertiger TSMC hinterher. Gleichzeitig verliert Intel Marktanteile bei klassischen Prozessoren an den Erzrivalen AMD. Daher gilt das Unternehmen inzwischen als Übernahmekandidat. Staatliche Unterstützung wird CEO Tan helfen und die dringend benötigte Neuaufstellung des früheren Vorzeigeunternehmens aus dem Silicon Valley vorantreiben.
Andererseits sind die Risiken so eines Deals nicht zu übersehen. Der Einstieg der Regierung für Intel könnte zu einem Pyrrhussieg werden. Denn staatliche Unterstützung ist selten bedingungslos, und Auflagen könnten die unternehmerische Freiheit von Tan erheblich einschränken. Branchenanalysten warnen, dass Intels Probleme tiefer reichen. Das Geschäftsmodell ist veraltet und die Produktpalette schlecht auf den KI-Boom abgestimmt. Strategische Fehltritte von Tans Vorgänger Pat Gelsinger haben dazu geführt, dass das Unternehmen sowohl im Fertigungs- als auch im Designbereich den Anschluss an die Konkurrenz verloren hat.
"Intel hat in den letzten drei Jahren fast 40 Milliarden Dollar verbrannt, um seine Produktionsführerschaft zurückzugewinnen. Doch die Ergebnisse bleiben enttäuschend", fasst es das "Wall Street Journal" zusammen. Der neueste Produktionsprozess 18A werde hauptsächlich für Intels eigene Chips genutzt, was bedeute, dass externe Kunden wenig Interesse daran zeigten. Beobachtern fehlt eine klare Strategie, wie Intel wieder konkurrenzfähig werden kann. Staatliche Mittel sind kein Ersatz dafür.
Trumps Strategie: Der "CEO von allem"
Vor allem aber wird die Trump’sche Strategie zunehmend kritisch beäugt: Intel ist nur das jüngste Beispiel seiner interventionistischen Wirtschaftspolitik. Der Präsident greift durch Zölle, Exportbeschränkungen oder direkte Einflussnahme auf Unternehmensentscheidungen zunehmend in den Privatsektor ein. So zwang er Nvidia und AMD zuletzt, der Regierung 15 Prozent ihrer Umsätze in China abzugeben. Und bei der Übernahme von US Steel durch Nippon Steel sicherte er sich eine "Goldene Aktie", die ihm weitreichende Kontrollrechte einräumt.
Diese Eingriffe folgen einem klaren Muster: Trump sieht sich nicht nur als Präsident, als Oberhaupt der Regierung, sondern inszeniert sich auch als Bestimmer und Lenker über die Geschicke der Privatwirtschaft. Kritiker warnen, dass seine Bestrebungen langfristig mehr Schaden als Nutzen anrichten könnten. Die Rede ist von "Staatskapitalismus", da Trumps Eingriffe in die Privatwirtschaft deutliche Parallelen zu staatlich gelenkten Wirtschaftsmodellen zeigen, wie sie in China üblich sind. Diese Art von Industriepolitik kann zwar kurzfristig Vorteile bringen, langfristig aber gefährdet sie die Prinzipien der freien Marktwirtschaft, weil sie den Wettbewerb verzerrt, Innovationen hemmt und Unternehmen dazu zwingt, politische statt wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen.
"Mit einer zu aktiven Wirtschaftspolitik kann man den Grundstein für einen dauerhaften Misserfolg legen, weil die Unternehmen dann nicht mehr effizient sind und nicht mehr das beste Produkt auf dem Markt anbieten, sondern sich darauf verlassen, dass sich der Staat um sie kümmert", erläutert Portfoliomanager Iredi bei ntv. Während die nationale Sicherheit und die technologische Souveränität der USA legitime Anliegen sein mögen, bleibt die Sorge, dass mit dem Staatseinstieg die Probleme nur ausgesessen werden. Das reinigende Gewitter bei Intel bleibt aus.
Im schlimmsten Fall schafft die staatliche Unterstützung neue Abhängigkeiten und schwächt die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens weiter- und führt Intel schließlich in den Abgrund. Diese Option wirft Wirtschaftsjournalist Bill Saporito in der "New York Times" in den Raum, denn der US-Präsident hat eine unternehmerische Bilanz, die zur Vorsicht mahnt: "Trump hat als Kapitän sechs Unternehmen in den Bankrott gesteuert." Oder mit anderen Worten: Trumps Hilfsangebot an Intel ist ein vergiftetes Geschenk.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke