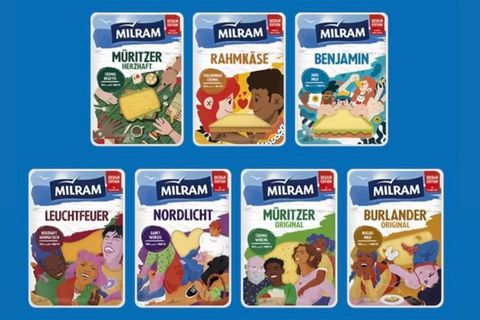Der leise Abgang des lauten Revolutionärs
Ende 2024 sollte es bei N26 noch einmal so richtig nach Aufbruch aussehen. Bei einer vielstündigen Präsentation in der Berliner Zentrale feierte sich die Digitalbank für Aktivitäten auf Rekordniveau und das beste Quartal seit der Gründung. Und als Gründer Valentin Stalf behauptete, dass sich der Abstand zu vielen Konkurrenten zuletzt nicht etwa verringert, sondern weiter vergrößert habe, klang tatsächlich der alte Angriffsgeist durch. Der hatte das Berliner Unternehmen nicht nur zu einer der bekanntesten Digitalbanken Deutschlands, sondern zu einem der wertvollsten Start-ups Europas gemacht hatte.
Nun aber ist die Reise für Stalf zu Ende – zumindest in der bisherigen Funktion. Und das nicht ganz freiwillig. In der vergangenen Woche hatten zunächst fast zeitgleich das „Manager Magazin“ und die „Wirtschaftswoche“ über neuen Ärger mit der Finanzaufsicht BaFin und gegen Stalf gerichtete Absetzungspläne wichtiger Investoren berichtet.
Nun folgt der Vollzug: Wie N26 am frühen Dienstagnachmittag mitteilte, wird der Gründer „zeitnah“ vom Vorstand in den Aufsichtsrat wechseln. Mit ihm verabschiedet sich nicht nur das Gesicht der Bank, sondern eine der prägenden Figuren der deutschen Digitalwirtschaft aus dem operativen Geschäft. Für die Digitalbank kann der Wechsel auch eine Chance, womöglich gar ein Aufbruchsignal sein.
Solche hatte Stalf vor rund zehn Jahren in großer Zahl und sehr vernehmlich gesendet. Gestützt auf eine App, die damals neue Maßstäbe setzte, ließ der Österreicher deutlich verlauten, dass er sich der konventionellen Konkurrenz uneinholbar entrückt fühlte. „An einem Oldtimer können Sie ja auch so viel herumschrauben, wie Sie wollen, er wird nie so sicher und effizient sein wie ein neues Auto“, tönte der N26-Chef etwa 2016 im Streitgespräch mit dem Vorstand einer traditionellen Großbank.
Während er zunächst noch erklärte, auf traditionelles Marketing weitgehend verzichten zu können, pflasterte N26 zwei Jahre später viele deutsche Innenstädte ganz analog mit Plakaten zu. Der Slogan „No Bullshit“ passte zum Anspruch eines Instituts, dass vieles anders und möglichst alles besser macht.
Die Behörde bremst
Heute gibt sich N26 als „erste Onlinebank, die du lieben wirst“ nicht nur im Werbeauftritt deutlich gezähmt. Grund dafür sind die merklichen Bremsspuren der vergangenen Jahre. Kunden klagten über schlechten Service, häufige Wechsel im Führungspersonal sorgten intern für Unruhe. Vor allem aber funkte die Finanzaufsicht Bafin entscheidend dazwischen.
Wegen Problemen bei der Geldwäscheprävention entsandte die Bonner Behörde einen Sonderbeauftragten und beschränkte schließlich auch das Wachstum bei Neukunden. Die Intervention der Bürokraten bremste die Dynamik entscheidend aus. Wettbewerber, die eben noch gleichauf waren, zogen davon.
Bei der letzten Finanzierungsrunde Ende 2021 sammelte das Unternehmen umgerechnet dennoch rund 800 Millionen Euro ein, seine rechnerische Bewertung stieg damit auf neun Milliarden Euro. Anschließend folgten selbst für ein Startup ungewöhnlich heftige Volten. Die Expansion in die USA brach N26 nach kaum mehr als einem Jahr wieder ab, auch den Versuch, in Brasilien Fuß zu fassen, gab das Unternehmen schnell wieder auf. Den 2022 ernsthaft diskutierten Börsengang verschob Stalf 2024 in die fernere Zukunft.
Die Story dafür dürfte sich kaum von selbst schreiben. Auch wenn das Unternehmen weiterhin wächst, hat es sein Alleinstellungsmerkmal verloren. Fast jede Bank hat heute eine App, die die Bedürfnisse ihrer Kunden zumindest zufriedenstellend erfüllt. Bei Zukunftsthemen wie dem Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen sowie im Geschäft mit Selbstständigen und Geschäftskunden sind Konkurrenten wie Trade Republic und Revolut weit vorn. Mit Spezialofferten wie der unbegrenzten Zahl von Gratistrades will N26 verlorenes Terrain zurückgewinnen. Manche Beobachter sehen solche Angebote jedoch schon fast als Akte der Verzweiflung.
Weit vorne sah sich das Unternehmen dagegen bei digitalen Immobilienkrediten, das in den Niederlanden gestartete Angebot wollte N26 gerne europaweit ausrollen. Ausgerechnet hier aber fanden die Bonner Finanzaufseher schon vor Monaten neuen Anlass zu meckern. Nach Medienberichten soll dies nur einer von zahlreichen neuen Kritikpunkten gewesen sein. N26 will sich weder zum Inhalt des Dialogs mit der Aufsichtsbehörde noch zu möglicher Kritik von Investoren äußern.
Viele Kenner des Unternehmens trauen ihm wie auch anderen neuen Digitalbanken noch einiges zu. „Ein Punkt für Differenzierungen bleibt die Integration verschiedener Funktionen“, sagt Georg Hauer, Ex-Deutschlandchef von N26 und heute Berater für Digitalunternehmen. Hier gehe es zum Beispiel um die Frage, wie einfach sich Konto und Depot gemeinsam steuern ließen. Zudem seien die Banken der neueren Generation auch technologisch weit vorn, während das Grundgerüst der Technik auch vieler etablierter Digitalbanken heute oft schon 25 Jahre alt sei. Vieles werde dort noch manuell erledigt, die Fixkosten seien deshalb höher. „Die ING etwa beschäftigt in Deutschland proportional weit mehr Mitarbeiter als N26“, sagt Hauer.
Den Vorteil hat N26 bisher allerdings nicht wirklich in Zahlen umgemünzt. Ende 2024 war die Digitalbank zwar erstmals in ihrer Geschichte profitabel, im Gesamtjahr fiel jedoch anders als bei vielen Wettbewerbern abermals ein Verlust an. Aktuell schreibt sie nach Angaben einer Sprecherin nachhaltige Profite, das zweite Halbjahr werde sie profitabel abschließen.
Ob sich sein Unternehmen doch noch zur Gewinnmaschine entwickelt, wird Stalf vom Aufsichtsrat aus verfolgen, den Vorsitz im Gremium wird er nicht übernehmen. Sein Wort wird aber schon deshalb Gewicht haben, weil er weiterhin ein großer Anteilseigner ist – gemeinsam mit Max Tayenthal gehören ihm rund 20 Prozent von N26. Sein Co-Gründer soll im Vorstand verbleiben, in dem perspektivisch eine Lücke klafft.
Ob der derzeitige Aufsichtsratschef Marcus Mosen in das Leitungsgremium wechselt, ist nach Auskunft von N26 noch nicht entschieden, der neue Risikochef fängt erst am ersten Dezember an. Eine Qualifikation könnte im Führungsgremium künftig durchaus von Vorteil sein: Erfahrung im traditionellen Bankgeschäft.
Dieser Artikel wurde für das Wirtschaftskompetenzzentrum von WELT und Business Insider erstellt.
Cornelius Welp ist Wirtschaftskorrespondent in Frankfurt. Er schreibt über Banken, Versicherungen, Finanzinvestoren und Unternehmen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke