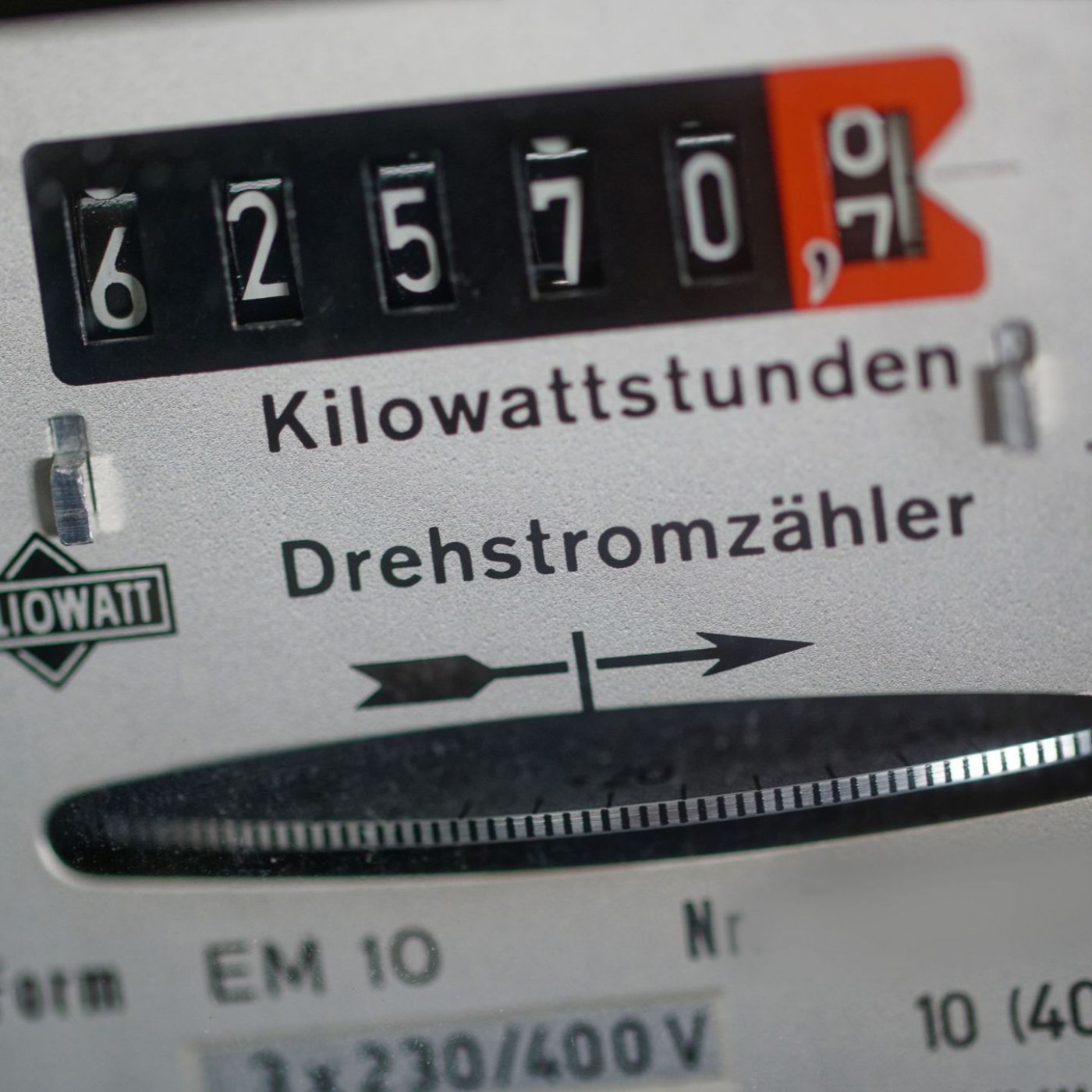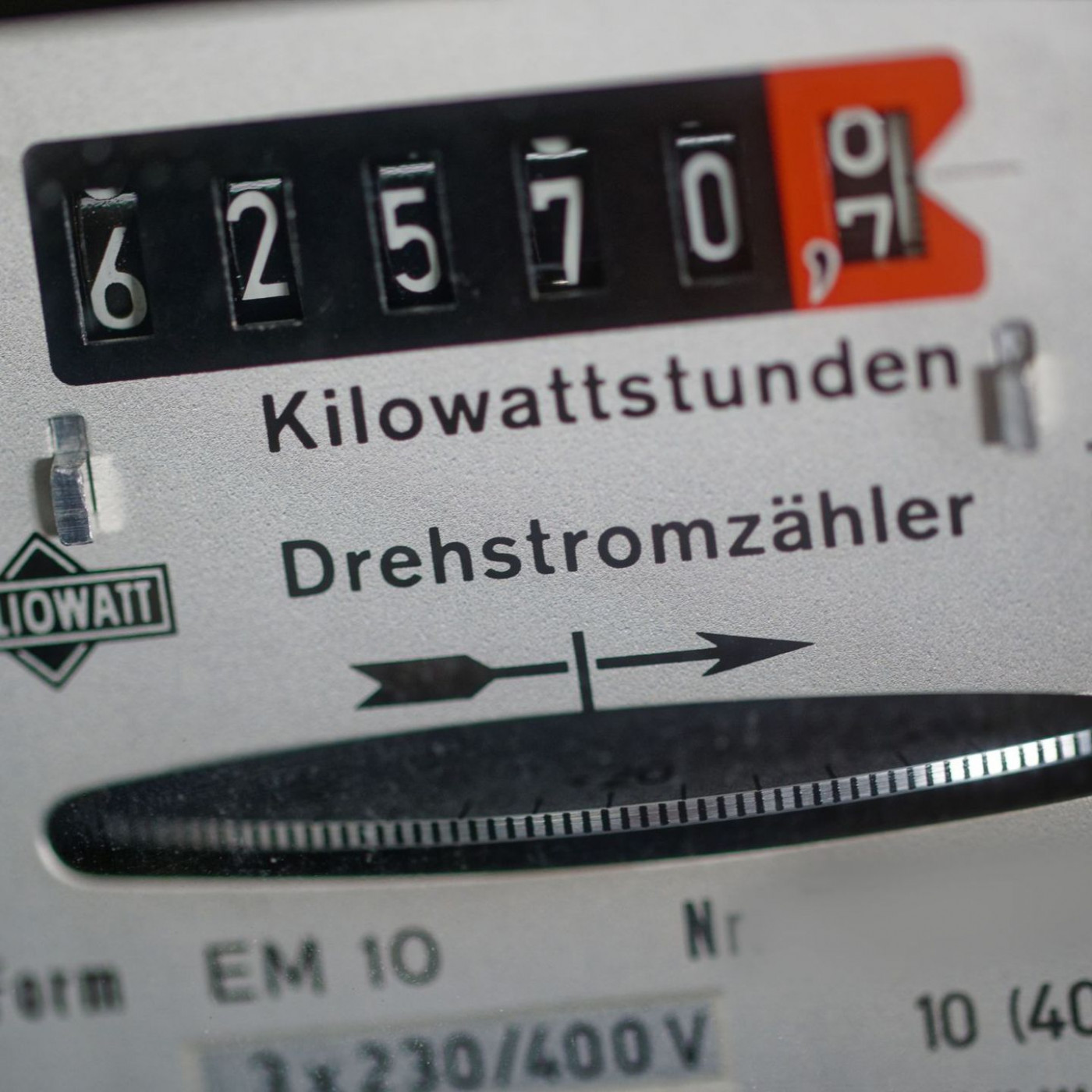Von allen Seiten unter Beschuss
Auf der weiten Ebene ist ihr Dröhnen schon lange zu hören, bevor sie am Horizont erscheinen. Kampfpanzer vom Typ „Leopard“ und Schützenpanzer „Marder“ rollen über die Heidelandschaft heran, die Leoparden vorweg, die langsameren Marder hinterher. Die Leoparden umgehen das Laubwald-Areal, das vor ihnen liegt, die Marder fahren über die morastigen Wege mitten hinein. Dann klappen ihre Ladeluken auf, und schwer bewaffnete Panzergrenadiere sitzen ab zum Gefecht.
Schnellfeuergewehre rattern jetzt im Wald, dazwischen knallen die Maschinenkanonen der Marder. Die Soldaten, von denen einige auch mit Panzerfäusten ausgerüstet sind, drängen durch den dichtstehenden Birken- und Buchenwald hindurch, im Gefechtslärm rufen sie sich Beobachtungen und Befehle zu.
Dann herrscht plötzlich einen Moment lang Ruhe, bevor die Motoren der Marder wieder hochdrehen und die Schützenpanzer zurück aus dem Wald herausfahren – Gefechtspause. Soldaten kommen zwischen den Bäumen hindurch und sammeln sich auf dem offenen Terrain nebenan zur Manöverkritik und Zwischenbilanz des Angriffs. An einer der Straßen, die sich durch das Gelände ziehen, stehen olivgrüne Geländewagen des Typs Toyota Landcruiser mit weißen Kreuzen darauf, es sind die Fahrzeuge der „Schiedsrichter“, die zugleich auch Ausbilder sind. Die erklären den übenden Soldaten nun, was sie richtig oder falsch, gut oder schlecht gemacht haben.
„An der Übung heute nehmen vier Leopard, zehn Marder und zwei Radpanzer Fuchs teil“, sagt Hauptmann Alexander Helle, einer der Sprecher des Gefechtsübungszentrums (GÜZ) nahe der Stadt Gardelegen im Kreis Salzwedel. „Wichtig ist, dass die Soldaten so realistisch wie möglich trainieren, wie sie im Ernstfall auch kämpfen würden.“
Welche Rolle sollen klassische Kampf- und Schützenpanzer künftig auf einem Gefechtsfeld spielen, das immer stärker von Drohnen und automatisierten Waffensystemen geprägt wird? Vor allem der Ukrainekrieg hat diesen Strukturwandel seit Russlands Überfall auf das Nachbarland im Februar 2022 deutlich beschleunigt. Wie sinnvoll sind die Anschaffungskosten für einen Kampfpanzer Leopard, der in seiner modernsten Version 2A8 heutzutage mehr als 20 Millionen Euro je Fahrzeug kostet – wenn zugleich relativ billige Drohnen auch bei der Bekämpfung moderner Panzer immer effektiver werden?
Auf dem Gefechtsübungszentrum des Heeres bei Gardelegen bekommt man Antworten auf solche Fragen, zum Beispiel von Oberst Jörg Tölke, der seit August als Kommandeur die Panzertruppenschule Munster südlich von Hamburg mit deren rund 1150 Soldatinnen und Soldaten führt. Tölke ist in Gardelegen, um sich Einblicke in den aktuellen „Einheitsführerlehrgang“ zum Kompaniechef zu verschaffen. Zwei Wochen dauert der Lehrgang mit 16 Teilnehmern, in diesem Fall sind es nur Männer. Die Soldaten und einige ihrer Panzer wurden dafür aus Munster zum GÜZ verlegt.
„Die Aufgabe der Panzertruppen – von Kampfpanzern und Panzergrenadieren – war und ist es, Raum zu nehmen, Raum zu halten“, sagt Tölke. „Das wird auch in der Zukunft nicht anders sein, egal, wie die Automatisierung voranschreitet. Auch wenn neue Systeme wie Drohnen eingeführt werden, wird sich die grundlegende Aufgabe der Panzertruppen nicht ändern. Wo man sich sicherlich anpassen muss, ist die Frage, wie schaffe ich den nötigen Schutz für die Kampf- und Schützenpanzer? Wie ermögliche ich den gepanzerten Truppen, ihre Aufgabe zu erfüllen?“
Das gilt aus Tölkes Sicht auch für die Inhalte der Ausbildung: „Die Kernaufgaben für diejenigen, die wir ausbilden, die Panzerkommandanten, die Zugführer oder Kompaniechefs, bleiben zunächst mal gleich. Marsch und Angriff, die Verteidigung mit gepanzert Kampftruppen, das wird sich nicht groß ändern“, sagt er. „Hinzu kommt die Bedrohung durch Drohnen oder auch das Nutzen eigener Drohnen als weitere Facette. Das ändert aber nicht das Grundsätzliche, was wir ausbilden. Insofern bleiben große Teile der Ausbildung gleich. Man muss das Programm um die Dreidimensionalität durch Drohnen am Himmel oder auch Drohnen am Boden erweitern. Der Kern bleibt, viele Ausbildungsinhalte bleiben. Man muss sie nur modern anpassen.“
Dieses Signal will die Bundeswehr auch mit dem Aufbau ihrer modernsten Heereseinheit setzen. Die neue Panzerbrigade 45 in Litauen zum Schutz der Nato-Ostflanke vor einer russischen Aggression soll Ende 2027 voll einsatzfähig sein. Der Großverband umfasst dann 4800 Soldatinnen und Soldaten, 200 zivile Kräfte sowie etwa 2000 Militärfahrzeuge mit der Hauptwaffe des Leopard 2A8, mit Schützenpanzern Puma, Artillerie des Typs Panzerhaubitze 2000 und den neuen Luftabwehrpanzern „Skyranger“.
Zu den Fähigkeiten der Brigade im System der verbundenen Waffen werde vor allem auch ein zeitgemäßer, effektiver Schutz gegen Drohnen und Flugzeuge gehören, sagte Brigadegeneral Christoph Huber, Panzergrenadier und Gründungskommandeur der Brigade, kürzlich WELT: „Nötig ist ein 360-Grad-Schutz gegen Bedrohungen aus der Luft, damit wir als Heeresgroßverband weiter operieren können. Wir unternehmen mit der Nato große Anstrengungen, um das zu erreichen.“
Eine maßgebliche Voraussetzung dafür ist die Ausbildung der Panzertruppe. Das Gefechtsübungszentrum in der Colbitz-Letzlinger Heide ist die zentrale Ausbildungsfläche des deutschen Heeres und nach Einschätzung der Bundeswehr die modernste Anlage dieser Art in Europa. Mehr als 23.000 Hektar – 230 Quadratkilometer – umfasst der Truppenübungsplatz in der Altmark nördlich der Landeshauptstadt Magdeburg. Die Ausdehnung des Manövergeländes entspricht in etwa der von ganz Duisburg. Allein zwölf Kilometer lang und vier Kilometer breit ist die Übungsfläche, die für den „Einheitsführerlehrgang“ genutzt wird.
Für Laien wirkt das groß, für die Profis in der Armee schon weniger, denn die Besatzung eines Leopard-Panzers würde ihre Ziele im Ernstfall in einer Entfernung von bis zu vier Kilometern bekämpfen.
Im GÜZ allerdings fällt „kein scharfer Schuss“, sagt Hauptmann Helle. Das Besondere an diesem Manövergelände sei vor allem die digitale Ausstattung. Panzergrenadiere und Schützenpanzer feuern mit Platzpatronen. Bei den Kampfpanzern werden die Schüsse nur simuliert. Jeder Schuss und jeder Treffer eines Soldaten oder eines Panzers werden elektronisch aufgezeichnet, ebenso jeder Funkspruch und jede Position der Soldaten im Gefecht.
Grundlage dafür ist das laser- und sensorgestützte System AGDUS. „Wir können eine Gefechtsübung komplett aufzeichnen, um die Abläufe mit den Soldaten anschließend im Detail zu analysieren“, sagt Helle. „Vor allem das ist der große Unterschied zum Truppenübungsplatz in Munster. Obendrein haben wir hier aber auch mehr Fläche, damit sich die Kampfpanzer und die Panzergrenadiere in simulierten Gefechten mit ihren Aktionen tatsächlich ,entfalten‘ können.“
Bei der Zwischenbesprechung am Rande des Wäldchens diskutieren die Lehrgangsteilnehmer mit Ausbildern und höheren Offizieren den Ablauf. Rekonstruiert wird etwa, wie schnell die Schützenpanzer Marder beim simulierten Angriff vorangekommen sind. Die Schützenpanzer mit den Panzergrenadieren müssen die Kampfpanzer decken und schützen, wenn die auf Hindernisse wie gegnerische Infanterie, Minen oder Panzersperren treffen. Dazu müssen sie mit den Kampfpanzern Schritt halten, sonst kann eine „Einbruchstelle“ durch die gegnerische Linie nicht effektiv gesichert werden.
Der kombinierte Angriff von Kampf- und Schützenpanzern bedarf viel Abstimmung der Soldaten untereinander. Die betagten Marder-Panzer sind im Gelände maximal 30 Stundenkilometer schnell, viel langsamer als die Leoparden, obwohl auch die im GÜZ eingesetzten Kampfpanzer schon Fahrzeuge der älteren Typen 2A5 und 2A6 sind. Bei den Kampftruppen wird der Marder schon seit einiger Zeit durch den modernen und wesentlich schnelleren „Puma“ ersetzt, doch bei der Ausbildungstruppe sind die neuesten Muster noch nicht angekommen. Lange Zeit wurde an der Bundeswehr gespart, wo es nur ging.
Für den simulierten Kampf verfügt das GÜZ über eine Truppe von 600 Soldaten und rund 200 Personen zur Unterstützung, etwa bei der Logistik. 18 Kampfpanzer und 15 Schützenpanzer sind auf dem Truppenübungsplatz stationiert, der neben seiner digitalen Zentrale und einem Zeltlager für mehrere Hundert Soldaten auch Strukturen einer Kleinstadt umfasst. Die wurden vor einigen Jahren gebaut. In „Schnöggersburg“ – ein Dorf dieses Namens gab es dort früher tatsächlich – können die Soldaten den Haus- und Stadtkampf üben.
Bei simulierten Gefechten wie im „Einheitsführerlehrgang“ bildet die Stammbesatzung des GÜZ üblicherweise die „rote“ Gruppe, die auszubildenden Soldaten greifen mit der „blauen“ Gruppe an. Die „Roten“, sagt Helle, könnten bei den Manövern ihre „Abwehrintensität“ je nach aktueller Lage und Bedarf steigern oder abschwächen. Nach der Besprechung mit den Ausbildern sitzen die Panzergrenadiere wieder auf die Schützenpanzer auf und kehren, wie auch die Kampfpanzer, in die Ausgangsstellung einige Kilometer entfernt zurück, um den Angriff von dort aus zu wiederholen.
Das GÜZ kann die Komplexität solcher Übungen mit anderen Truppenteilen noch erhöhen. Hauptmann Hendrik, 28, nimmt als Offizier der Panzertruppe und früherer Panzerkommandant an dem Lehrgang teil. Der Soldat, der zurzeit an der Panzertruppenschule in Munster dient, will Kompanieführer werden. „Mich hat das Waffensystem der Panzertruppe immer fasziniert, die Schnelligkeit in Verbindung mit der Feuerkraft“, sagt der Hauptmann, der nur mit seinem Vornamen und Rang genannt wird, wie bei Berichten über die Bundeswehr zumeist üblich. „Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften haben in dieser Truppengattung eine sehr enge Verbindung, das sehen wir hier im GÜZ auch bei den Gefechtsübungen wieder.“
Major Stefan, 38, ist bereits Kompaniechef bei den Panzergrenadieren und muss den „Einheitsführerlehrgang“ ebenfalls absolvieren: „Meine Großväter und mein Vater waren bei der Panzertruppe. Ich wollte etwas anders machen – und bin Panzergrenadier geworden“, sagt er. Die Panzertruppe hält er, trotz rasanter Veränderungen bei den Militärtechnologien, für eine zukunftsfähige Waffengattung: „Es kommen immer wieder neue Waffensysteme hinzu, aber auch der Kampfpanzer ist seit dem Ersten Weltkrieg immer weiterentwickelt worden.“
Zur Sinnhaftigkeit des Wehrdienstes, die in Deutschland inzwischen wieder intensiv diskutiert wird, haben die beiden Berufssoldaten in ihrer Kampfausrüstung auf dem Manövergelände eine klare Meinung. „Ich halte die Wiedereinführung des Wehrdienstes für gut und richtig. Wir müssen als Gesellschaft wieder stärker zusammenrücken“, sagt Major Stefan. „Ideal wäre sicher ein ,Gesellschaftsdienst‘ für Männer und Frauen. Das würde die breitestmögliche Basis dafür schaffen, dass die junge Generation ihrem Land etwas zurückgibt.“
Und Hauptmann Hendrik sagt: „Ein ,Gesellschaftsdienst‘ als Alternative von Wehr- und Zivildienst wäre wohl am besten geeignet, um die gesellschaftliche Resilienz zu stärken, ohne einem Menschen von vornherein eine bestimmte Dienstform aufzuzwingen.“
Die Übung der Panzertruppe wird am Nachmittag fortgesetzt. Drei Leoparden rollen in kurzem Abstand über das weite Feld heran in ihre Bereitstellung. Die mehr als 60 Tonnen schweren Kolosse wippen durch die Bodenwellen, die die Kampffahrzeuge mit ihren Kettenlaufwerken in die weiche Erde graben. Bei einem der Panzer ist der Turm seitlich gedreht, das Geschütz gesenkt. In der Mündung steckt das Okular des AGDUS-Lasersystems. Wie eine surreale Riesenechse mit Rüssel und Auge wirkt der Panzer beim Vorbeirollen. Die Maschinen mit ihrer tödlichen Zerstörungskraft rattern durch den Heideschlamm in Sachsen-Anhalt, damit Europa der Ernstfall erspart bleibt.
Olaf Preuß ist Wirtschaftsreporter von WELT und WELT AM SONNTAG für Hamburg und Norddeutschland. Er berichtet regelmäßig über die Rüstungsindustrie und auch über die Bundeswehr.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke