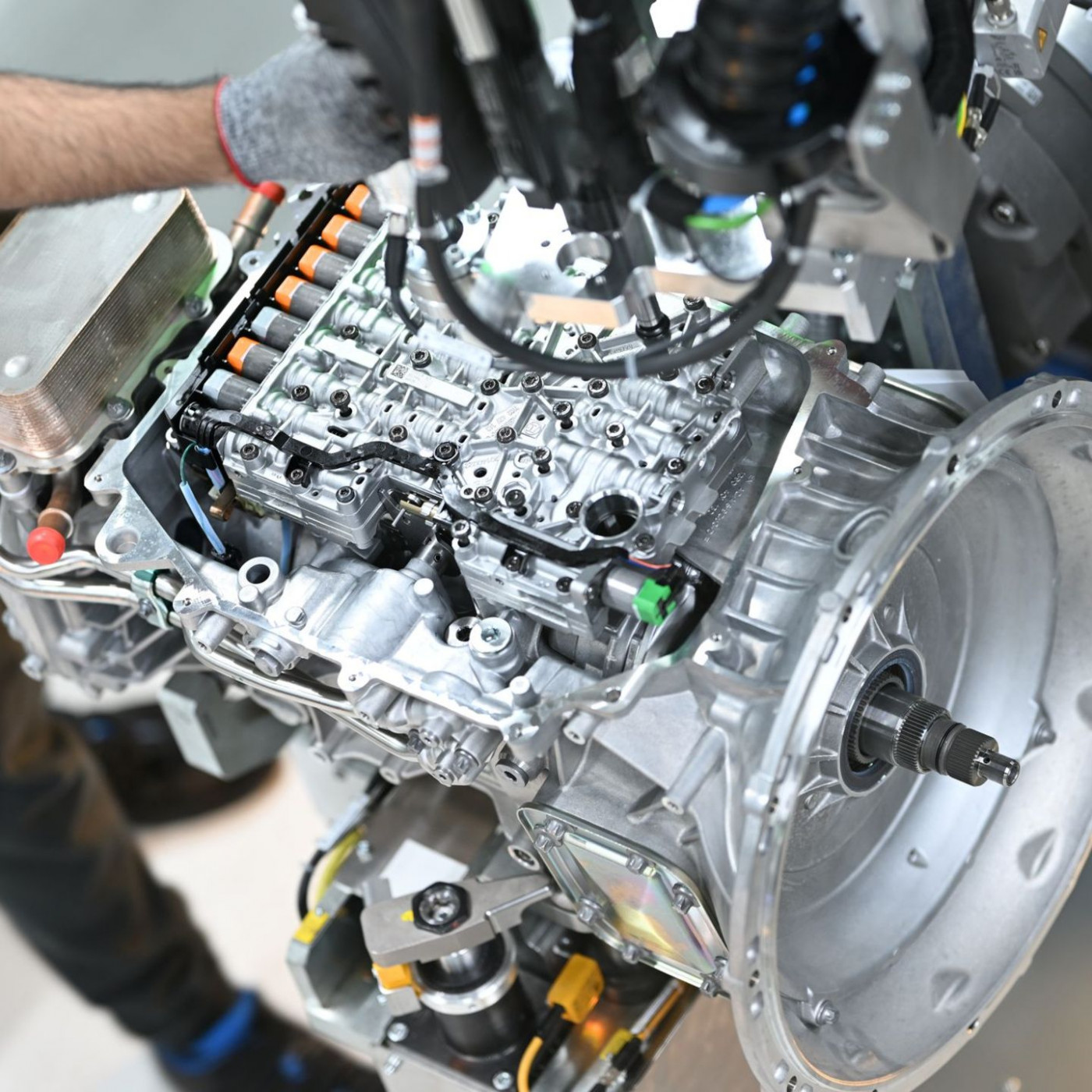Genialer Angriff gegen TikTok und Instagram? Das Problem mit OpenAIs neuer Video-App
Das ChatGPT-Unternehmen OpenAI bietet seit einigen Tagen ein neues KI-Programm namens Sora im Appstore von Apple an, die Idee: Nutzer sollen nicht länger nur mit der Künstlichen Intelligenz (KI) chatten, sondern auch Kurzvideos mit ihrer Hilfe erstellen. Diese Videos können sie auch gleich in der App weiter verwenden und teilen.
Die App basiert auf dem verbessertem Medien-KI-Modell „Sora 2“ von OpenAI, sie ermöglicht Nutzern die Erstellung hochauflösender Videos aus einfachen Texteingaben. Zudem können die User eigene Bilder direkt als lebensechte Cameo-Auftritte von sich und ihren Freunden in Videos einbetten.
Die Idee erscheint auf den ersten Blick spaßig und gewinnversprechend, OpenAI tritt damit direkt in Konkurrenz mit sozialen Kurzvideo-Netzwerken wie dem chinesischen Tiktok oder Instagram aus dem Hause Meta. Die App der ChatGPT-Mutter ist wie geschaffen dafür, virale Videos zu erschaffen. Doch viele der an den ersten Tagen nach dem App-Store-Start veröffentlichten Videos haben auch bei Urheberrechts- und Deepfake-Experten Alarm ausgelöst.
Denn OpenAI interpretiert ganz nebenher auch das Urheberrecht für Bewegtbild-Inhalte neu. Aktuell posten die Nutzer auf der App fröhlich selbsterstellte Star-Wars-Parodien mit sich selbst und Darth Vader, lassen die KI Nintendos Superhelden Super Mario neu interpretieren oder die weltweit erfolgreiche Cartoonfigur SpongeBob Reden im Stil von Adolf Hitler halten.
Bei einem einzigen Blick in die App begegnen einem in den populärsten Videos gleich einige dutzend Videos mit Figuren aus der Popkultur, die klar zuzuordnen und definitiv durch Markenrechte geschützt sind: Sketche der Cartoon-Familie „Die Simpsons“, die drastisch Donald Trump kritisieren, oder James Bond, wie er den OpenAI-Gründer Sam Altman im Poker schlägt.
OpenAI selbst hat zum Start seiner App kurzerhand verkündet, dass Rechteinhaber, die ihre geschützten Figuren, Trademarks oder Inhalte in der Sora-App wiederfinden, sich über ein Opt-Out-Verfahren dagegen wehren sollen. Diese Herangehensweise aber würde in so gut wie allen für OpenAI relevanten Märkten gegen geltendes Urheberrecht verstoßen.
Rechteinhaber ziehen selbst bei Bagatellen vor Gericht
Die Rechteinhaber können darauf vertrauen, dass kein anderes Unternehmen mit ihren Inhalten Geld verdient und gehen normalerweise bereits bei Bagatellverstößen von Privatleuten bereitwillig vor Gericht. Dabei wurden in der Vergangenheit regelmäßig hohe Schadensersatz-Zahlungen fällig.
Nicht allein in Sachen Urheberrecht ist die Sora-App aus juristischer Perspektive problematisch, sondern auch aus Sicht der Regulierung in Europa. Denn hierzulande schreiben die KI-Gesetze der EU vor, dass sogenannte Deep-Fake-Videos von echten Personen klar als KI-generiert gekennzeichnet werden müssen. Nicht einmal diese Regel erfüllt die neue App von OpenAI bislang.
Dieser Artikel wurde für das Wirtschaftskompetenzzentrum von WELT und „Business Insider Deutschland“ erstellt.
Benedikt Fuest ist Wirtschaftskorrespondent für Innovation, Netzwelt, IT und Rüstungstechnologie.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke