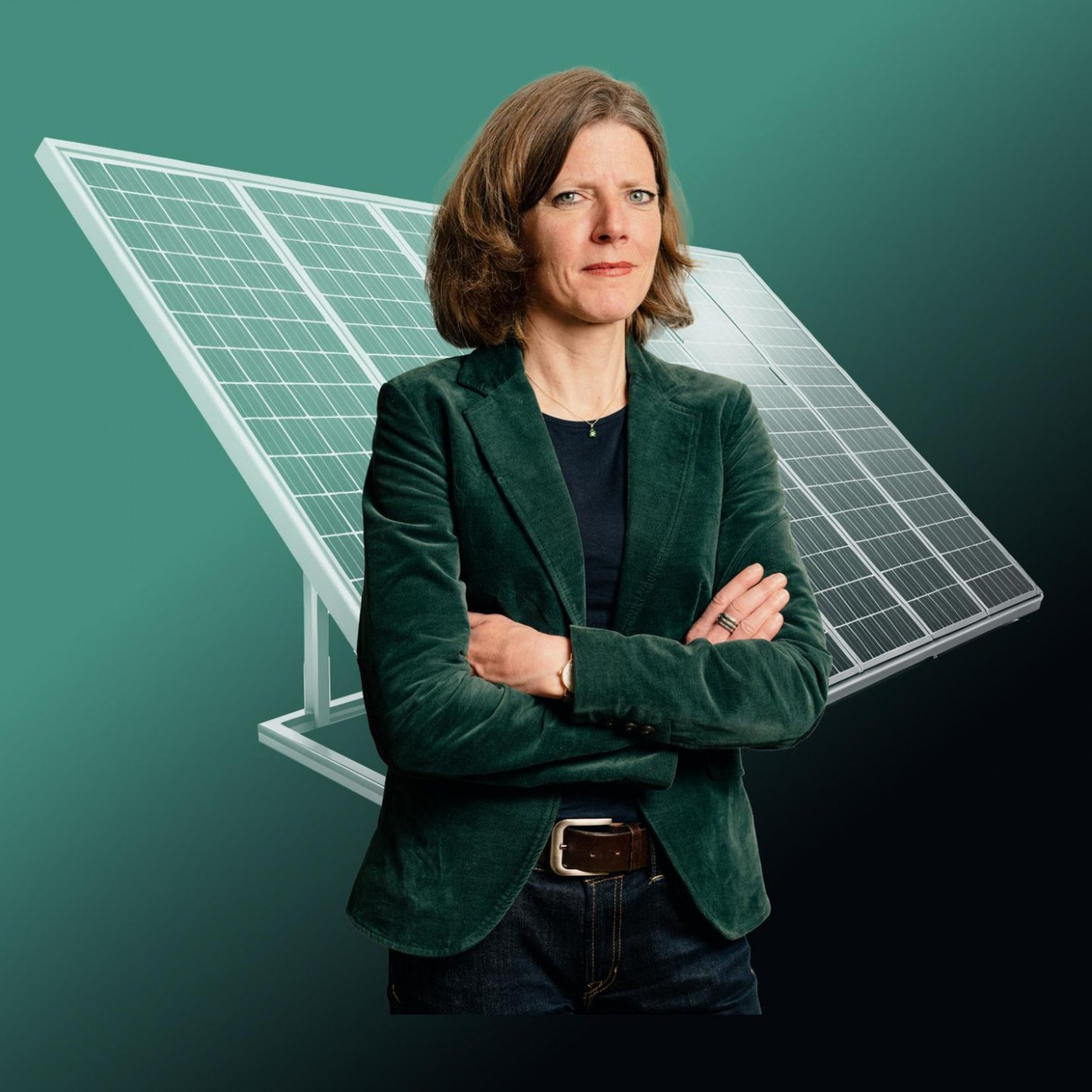„Viele junge Menschen sind das hierarchische System, das ein Betrieb nun mal ist, nicht gewohnt“
Mittlerweile hat es sich fast zu einem Ritual entwickelt. Jedes Jahr im Sommer erscheinen neue Daten zum Ausbildungsmarkt – hoffnungsvolle Nachrichten gibt es dabei kaum noch zu verkünden. Im Gegenteil, auch dieses Jahr schlagen die Arbeitgeber Alarm. 80.000 Betriebe können Stellen nicht besetzen: Das ist zwar ein minimaler Rückgang zum Vorjahr, aber ein viel höherer Wert als vor zehn Jahren.
Der Hauptgrund: Es finden sich immer weniger geeignete Bewerber. Gleichzeitig schlägt sich die Konjunkturschwäche in der Personalplanung nieder. Mehr als ein Viertel der Betriebe hat das Ausbildungsangebot laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) reduziert.
„Die Wirtschaftskrise schlägt sich auch am Arbeitsmarkt nieder“, sagt Achim Dercks, stellvertretender DIHK-Geschäftsführer. Doch die Probleme seien tiefgreifender: Für die strukturelle Krise ist auch verfehlte Bildungspolitik schuld, meint Dercks.
„Manchmal hat man den Eindruck, dass viele Politiker noch nie eine Berufsschule von innen gesehen haben, sondern nur die Universitäten kennen.“ Zwar gibt es etliche staatliche Programme. Für das „Startchancenprogramm“, den „Bildungspakt“ oder gezielte Förderung von Jugendlichen werden jedes Jahr Milliarden abgerufen. Die Initiativen seien nicht schlecht, sagt Dercks – nur seien sie wenig wirksam.
Im zuständigen Arbeitsministerium ist das Problem zwar bekannt. Wirkliche Konzepte, die an die Ursache des Problems gehen, fehlen aber. „Die Agenturen für Arbeit und Jobcenter unterstützen mit Beratung, Vermittlung und gezielten Förderangeboten“, sagt Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD).
„Kein Jugendlicher soll beim Übergang in das Berufsleben verloren gehen.“ Nur: Die Zahl der jungen Menschen, denen genau das passiert, ist deutlich angestiegen. Fast drei Millionen unter 35 haben keine Ausbildung. Oft sind sie es, deren Jobs am unsichersten sind – gerade in Krisenzeiten.
Dercks spricht von einem gesellschaftlichen Problem: „Es gibt zu viele Betriebe, die niemand finden und zu viele Jugendliche, die scheitern.“ Laut Bundesbildungsbericht ist unter den jungen Menschen ohne berufliche Qualifikationen der Migrationsanteil überdurchschnittlich hoch; auch sind es deutlich mehr Männer als Frauen.
„Mangelndes Deutsch ist ein großes Problem“, sagt auch Dercks. „Die Kompetenzen vieler Bewerber im Allgemeinen sind heute geringer als noch vor einigen Jahren.“ Rund die Hälfte der Betriebe beklagt „oft“ oder „immer“ einen Mangel an Ausdrucksvermögen und elementaren Rechenfähigkeiten unter den Bewerbern.
Ein reines Migrationsproblem sei die Azubi-Krise aber nicht. „Zu viele junge Menschen werden auch alleingelassen von Schulen und Elternhaus“, sagt Dercks. „Da geht es viel um soziale Kontakte“. Helfen könnten etwa sogenannte Ausbildungsbotschafter, die häufiger in den Schulen auftreten müssten.
Immer noch zeigten sich auch die Nachwehen der umstrittenen Politik in Bezug auf junge Menschen während der Corona-Pandemie. Durch Schulschließungen, aber auch durch soziale Einschnitte und den Rückzug ins Private, sei einiges auf der Strecke geblieben, meint Dercks. Häufig träfe nämlich Orientierungslosigkeit auf mangelndes Sozialverhalten.
„Das Phänomen der Digitalisierung des Lebens führt zu Vereinzelung. Viele junge Menschen sind ein Kollegen-Umfeld und das hierarchische System, das ein Betrieb nun mal ist, nicht gewohnt.“ Selbst viele derjenigen, die eine Lehrstelle finden, würden wenig später scheitern.
Dieser Artikel wurde für das Wirtschaftskompetenzzentrum von WELT und „Business Insider Deutschland“ erstellt.
Jan Klauth ist Wirtschaftsredakteur in Berlin. Er berichtet über Arbeitsmarkt-Themen, Bürgergeld, Migration und Sozialpolitik sowie Karriere-Themen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke