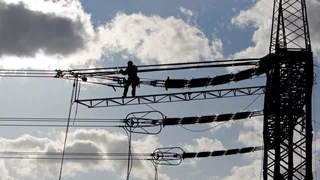„Wir wussten, Monsanto wird der Sargnagel. Und so ist es für uns jetzt gekommen“
Auf der Wiese rund um Marianne Maehl hallt es von Trillerpfeifen und Protestrufen. Zu Dutzenden skandieren die Mitarbeiter des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer im Industriepark Frankfurt-Höchst an diesem Junitag das Wort „Schande“. Die Verwaltungsangestellten und die Werksarbeiter im Blaumann, die sich auf der Wiese gruppiert haben, demonstrieren auf diese Weise gegen die Sparpläne ihres Arbeitgebers.
Denn der Konzern will das Werk in Höchst mit seinen gut 500 Mitarbeitern bis Ende 2028 dichtmachen. Maehl, die dem Betriebsrat am Standort vorsitzt, greift sich das Mikrofon. „Wir geben nicht auf. Wir kämpfen dafür, dass es hier weitergeht“, schallt ihre Stimme via Box über die umliegenden Bürokolosse und verliert sich hinter den Kühltürmen und Laboren.
Auch im gut 400 Kilometer entfernten Brüssel versammeln sich Anfang Juni Bayer-Mitarbeiter auf einer grünen Wiese. Statt zwischen Kühltürmen und Verwaltungsgebäuden liegt diese eingebettet zwischen Europäischem Parlament und naturhistorischem Museum. Statt Protestrufen schallt Ambient-Musik über die Fläche mit dem ausgestellten Traktor und den Saatgut-Neuheiten. Auf der Bühne im Festzelt ergreift Bayer-Vorstandschef Bill Anderson das Wort. Er berichtet von den „großen Fortschritten“, den Konzern zu verschlanken.
Andersons Suche nach mehr Effizienz und Einsparmöglichkeiten bei Bayer und Maehls Kampf gegen die Werksschließung in Höchst hängen eng zusammen. Denn beide Reden speisen sich aus der gleichen Wurzel: der Übernahme des US-Herstellers Monsanto im Jahr 2018. Was Bayer zum globalen Champion im Agrarbereich machen sollte, wirft seitdem Schatten über den gesamten Konzern.
Der Monsanto-Bestseller, der Unkrautvernichter Roundup, ist zum Ziel Abertausender Kläger in den USA geworden, die behaupten, von dem Produkt Krebs bekommen zu haben. Bayer widerspricht und versichert, das Mittel sei sicher und nicht krebserregend, was zahlreiche Behörden weltweit bestätigt haben. Dennoch haben die milliardenschweren Klagen das Zeug, den Konzern in seiner Existenz zu bedrohen.
Und die Klagewelle ist nicht das einzige Übel, das über den Atlantik nach Leverkusen schwappt. Seit Wochen droht US-Präsident Donald Trump europäischen Herstellern mit Strafzöllen – und legte kürzlich nach: Die Medikamentenpreise in den USA sollen um bis zu 80 Prozent sinken. Für Bayer wäre das ein schwerer Schlag: Der Konzern erwirtschaftet 35 Prozent seines Umsatzes in Nordamerika.
Für CEO Anderson, nach dem Monsanto-Debakel als Ersthelfer in den Vorstand geholt, wird das Rettungsmanöver allmählich zur Mission Impossible. Zumal sein aktueller Vertrag im nächsten Frühjahr endet. Viel Zeit bleibt damit nicht mehr. Gelingt es ihm, die Klagewelle unter Kontrolle zu bringen, könnte Bayer als Einheit überleben. Wenn nicht, droht der deutschen Industrie-Ikone die Zerlegung am Filettisch der Investoren.
Um das Schlimmste zu verhindern, greift Anderson nun zur Brechstange – und trifft damit auch den Heimatmarkt Deutschland. Erstmals in der mehr als 160-jährigen Firmengeschichte soll mit Frankfurt-Höchst ein kompletter Standort geschlossen werden, die Gewerkschaft IGBCE hat bereits Widerstand angekündigt. Auch an anderen Standorten soll Personal eingespart werden. Ist das Aus für Höchst der Anfang vom Ende – oder der Auftakt zu Bayers mühsamer Verwandlung in einen wieder erfolgreichen Konzern?
Monsanto-Klagen „signifikant eindämmen“
Das Brüsseler Festzelt von Bayer verwandelt sich binnen Minuten zu einem Schaulaufen des Top-Managements. An einem Stehtisch lehnt ein unscheinbarer Anzugträger mit Bürstenhaarschnitt und Hornbrille. Sein Umhängeschild weist ihn als Frank Terhorst aus, Leiter der Agrarsparte von Bayer. Eigentlich plant Terhorst die Zukunft von Bayers Agrargeschäft. An diesem Tag muss er sich jedoch Fragen zur Vergangenheit stellen. Denn Terhorst gilt neben dem damaligen Vorstandschef Werner Baumann als einer der Architekten des Monsanto-Deals.
Der Übernahme kann der Manager auch heute noch Positives abgewinnen. „Wenn wir den Zusammenschluss aus strategischer Sicht betrachten, stellt er eine wichtige Bereicherung für den Konzern und für die globale Landwirtschaft dar“, sagt Terhorst. Innovationszyklen im Agrarsektor könnten dadurch „erheblich beschleunigt“ werden.
Ob er den Deal heute erneut empfehlen würde, will Terhorst nicht konkret beantworten. Den „Ballast“ an Klagen zu Roundup will Bayer Terhorst zufolge bis Ende kommenden Jahres „signifikant eindämmen“. Um das zu erreichen, verfolge der Konzern eine „mehrgleisige Strategie“ auf US-Bundesebene und in den Bundesstaaten sowie vor dem US Supreme Court. Der Manager betont, dass der Konzern auch von vielen amerikanischen Landwirtschaftsorganisationen unterstützt werde.
Doch nicht nur wegen Roundup steht die Agrarsparte von Bayer unter Druck. Während der Corona-Jahre haben chinesische Hersteller ihre Kapazitäten bei Pflanzenschutzmitteln massiv ausgebaut. Nun drängen sie mit Preisen auf den Weltmarkt, die zum Teil unter den Herstellungskosten von Bayer liegen. „Auf diese veränderte Marktlage müssen wir reagieren“, sagt Terhorst.
Das trifft auch Deutschland, wo zentrale Produktionsstätten stehen. Bayer werde das Portfolio an den hiesigen Standorten modernisieren, kündigt Terhorst an – und versichert zugleich, dass Bayer sich mit diesen Maßnahmen „zukunftsfest“ aufstellen und zum Standort Deutschland bekennen werde.
Auf der Wiese in Frankfurt-Höchst halten mehrere Werksmitarbeiter aus der Pflanzenschutzproduktion, erkennbar an ihren Blaumännern mit eingenähtem Bayer-Kreuz, weiße Pappschilder in die Höhe. Der Schriftzug, den sie formieren, ergibt eine unmissverständliche Botschaft: „Wir werden kämpfen“.
Doch die Stimmung unter den Mitarbeitern ist eher gedrückt als kämpferisch. „Ich glaube nicht, dass das hier noch was wird. Die Chemie in Deutschland hat keine Zukunft mehr. Zu viele Auflagen, zu hohe Kosten“, sagt einer, der seit vielen Jahren am Standort Höchst für Bayer arbeitet. Nun gehe es nur noch darum, ein Zeichen zu setzen. „Wir wussten damals in der Belegschaft: Monsanto wird der Sargnagel. Und so ist es für uns jetzt auch gekommen.“
Betriebsrätin Marianne Maehl hingegen will die Hoffnung noch nicht aufgeben. Noch sei die Entscheidung nicht endgültig gefallen, sagt sie. Der Betriebsrat hat vor Kurzem einen Wirtschaftsberater beauftragt zu prüfen, ob die Schließung des Standorts in Frankfurt wirklich so alternativlos ist, wie es das Management suggeriert habe.
„Wir haben noch Hoffnung, dass wir die ein oder andere Einheit retten und hier in Höchst halten können, notfalls über den Verkauf an einen Wettbewerber“, sagt Maehl. Die Forschungspipeline sei voll, die Zahlen seien stimmig, und im internen Standortwettbewerb habe sich das Werk zuletzt noch bei der Produktion eines Reisherbizids durchgesetzt. „Das plötzliche Aus hat niemand verstanden“, sagt Maehl.
Was die langjährige Betriebsrätin besonders enttäuscht: Dass die Chefetage in Leverkusen so entschieden habe, ohne die Arbeitnehmerseite vorher anzuhören. „Dabei war Bill Anderson schon kurz nach seinem Amtsantritt hier. Er hat den Eindruck gemacht, als könne man mit ihm reden“, sagt Maehl. Nun zeige sich, dass Entscheidungen eben doch ganz amerikanisch einfach durchgezogen würden.
Sparpläne treffen nicht nur die Stadt Höchst
Am Stehtisch im Bayer-Festzelt scheint die Schließung von Höchst bereits ausgemachte Sache zu sein. „Wir sind leider gezwungen, unsere Aktivitäten in Deutschland zu konsolidieren, was dazu führt, dass wir den Standort in Frankfurt-Höchst nach Ende 2028 nicht fortführen können“, sagt Agrarmanager Terhorst. Wie viele der Arbeitsplätze in Höchst an andere Standorte verlagert werden können, sei Bestandteil der aktuellen Diskussion.
Die Sparpläne treffen nicht nur Höchst. Auch in Dormagen beabsichtigt Bayer, 200 von 1200 Stellen abzubauen. „Durch die Umstrukturierung richten wir den Standort Dormagen so aus, dass er auch in Zukunft weiter eine führende Rolle im globalen Produktionsnetzwerk von Bayer spielen kann“, sagt Terhorst. Mit den Arbeitnehmervertretungen arbeite der Konzern an sozial verträglichen Lösungen.
Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der Fondsgesellschaft Deka Investment, ist als Vertreter der Aktionärsseite nicht gerade der Gewerkschaftsnähe verdächtig. Bayers Entscheidung sieht der Kapitalmarktexperte dennoch kritisch. „Aus Nachhaltigkeitssicht steht bei Standortentscheidungen nicht nur die kurzfristige Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, sondern auch die Zukunftsfähigkeit und soziale Verantwortung eines Unternehmens, wie etwa der Erhalt von Arbeitsplätzen“, sagt Speich. „Standortschließungen sind häufig Ausdruck einer mangelnden Wettbewerbsfähigkeit von Produkten und Prozessen.“
Rund 92.800 Stellen weltweit weist Bayer im jüngsten Geschäftsbericht aus. Rund 99.800 waren es vor acht Jahren, bevor der Konzern den Hersteller Monsanto und damit auch etliche US-Klagen einkaufte. Im Rahmen von Andersons Spar- und Effizienzprogramm DSO wurden allein 2024 konzernweit rund 7000 Stellen abgebaut, keineswegs nur in der Produktion, sondern vor allem im Management.
Die Investoren am Kapitalmarkt hat das dennoch bisher wenig beeindruckt. Die Aktie, seit Jahren im Sinkflug, ist nur noch halb so viel wert wie vor Andersons Amtsantritt. „Bayer hat sich mit dieser Akquisition der strategischen Optionen beraubt und hat nun weniger Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft“, sagt Speich.
Auf der Wiese in Höchst löst sich die Versammlung langsam auf. Die nächste Schicht beginnt, der Betrieb muss weiterlaufen. Vorerst. Betriebsrätin Maehl verstaut das Mikrofon. In einer Stunde beginnt die nächste Demonstration, diesmal auf der Südseite des Industrieparks. Maehl blickt auf einen Backsteinbau in der Nähe der kleinen Wiese. In der früheren Standortzentrale hat die Chemielaborantin ihre Karriere einst gestartet. Ihr Arbeitgeber hieß allerdings nicht Bayer, sondern Hoechst.
„Damals gab es hier am Standort über 30.000 Mitarbeiter von Hoechst. Es tut weh zu sehen, wie sich eine Firma nach der anderen hier verabschiedet und viele geschätzte Kolleginnen und Kollegen schon gehen mussten“, sagt sie. „Und jede größere Firma zieht mehrere kleine nach sich, wie Dominosteine. Bis der letzte Stein fällt.“
Anja Ettel ist Korrespondentin für Wirtschaft und Finanzen in Frankfurt.
Andreas Macho ist WELT-Wirtschaftsreporter in Berlin mit dem Schwerpunkt Gesundheit.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke