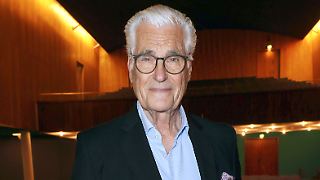Partys, Pillen, Plattenbauten - Nila will kein "Good Girl" sein
Nila ist jung und träumt vom Künstlerinnenleben in London oder New York - Hauptsache weit weg von Berlins Plattenbauvierteln, ihrem unglücklichen Vater und den Lügen über ihre Herkunft. Doch eine verhängnisvolle Affäre erschwert ihr die Flucht aus dem drogenverseuchten Untergrund der Hauptstadt.
Stroboskopblitze, Nebelschwaden, verschwitzte Körper: In den Technoclubs Berlins ist die 19-jährige Nila zu Hause. Zum Rhyhtmus des dröhnenden Basses schwebt sie Wochenende für Wochenende durch die Nacht, benebelt von Pillen und weißem Pulver, das sie sich auf schmutzigen Club-Toiletten mit Fremden durch die Nase zieht.
Von alldem darf ihr Vater natürlich nichts wissen. Ihr Vater, der nach dem plötzlichen Tod von Nilas Mutter betrübt in der kleinen Plattenbauwohnung sitzt und darauf wartet, dass seine Tochter endlich zur Vernunft kommt. Endlich etwas Anständiges mit ihrem Leben anfängt. Endlich ein - wie er sagt - gutes Mädchen wird.
Beim Nachhausekommen lügt Nila sich zwar an ihm vorbei, verschweigt den Alkohol, die Drogen und die mehr als 24 Stunden wachen Stunden. Doch er hat längst begriffen, was seine Tochter treibt. Aber eben auch, dass alles Schimpfen, Drohnen und Bitten nichts bringt. Nila will kein gutes Mädchen sein.
Dabei hat sie klare Karriereträume. Sie will nach London oder New York und dort Fotografie studieren. Talent hat sie, eine Kamera auch. Doch ihr fehlt der Glaube daran, dass sie, ein junges Mädchen aus der Sozialbausiedlung und Kind afghanischer Einwanderer, es schaffen kann. Gerade, als sich dann doch eine Möglichkeit zu bieten scheint, die Berliner Gropiusstadt - ehemalige Heimat von Christiane F. - zu verlassen, lernt Nila Marlowe kennen. Und ihre Pläne, der Stadt den Rücken zu kehren, verblassen.
Marlowe ist ein ehemals erfolgreicher Schriftsteller und fast doppelt so alt wie Nila. Und er nimmt sie in die (vermeintlich) intellektuellen Kreise des Berliner Kultur-Untergrunds mit. Er eröffnet ihr scheinbar neue Welten voller Geld und Glitzer. Und parallel verwickelt er sie in eine verhängnisvolle Affäre voller Sex und noch mehr Drogen, in der Nila sich vollkommen zu verlieren droht.
Nila will vergessen
Laut, rasant und ein bisschen dreckig: Aria Abers Debütroman "Good Girl" liest sich selbst wie ein rauschhafter Streifzug durch die Technoclubs Berlins - untermalt vom ständigen Beat einer Musik, die klingt, als würde sie "aus dem Erdkern heraus pulsieren". Eine Musik, die für Nila einer ganz eigenen Logik folgt und eigentlich keinen Sinn ergibt - "außer man zermatscht seine Nervenbahnen zu einem prähistorischen Brei". Das "schnelle High" ist für sie also die einzig logische Antwort auf das Wummern im Inneren ihres Stammladens - einem "Schock aus Stahl und Beton, Glas und Ketten und achtzehn Meter hohen Decken".
Die Drogen dienen aber nicht nur als Party-Treibstoff, sondern sollen Nila auch beim Verdrängen helfen. Der Tod der Mutter, das Unglück des Vaters, das Leben im Berliner Randbezirk, in dem Neonazis umherziehen und Häuserwände mit Hakenkreuzen beschmieren; der verhasste Job in einem Jazz-Café, die Überforderung mit dem Erwachsenwerden, die toxische Beziehung zu einem älteren Mann: Nila will vergessen.
Vergessen würde sie am liebsten auch ihre Wurzeln, die sie selbst ihren engsten Freundinnen und Freunden verschweigt. Niemand soll wissen, dass ihre Eltern aus Afghanistan kommen. Und dass ihr echter Name eigentlich gar nicht Nila ist. Sie hat gesehen, was die Vorurteile, die Klischees und der Rassismus mit ihren Eltern, Onkeln und Tanten gemacht haben. Nila will raus aus der Plattenbausiedlung und Künstlerin werden. Das Verschweigen der eigenen Herkunft ist für sie Teil der Milieu-Flucht.
Ecstasy, Speed und rechter Terror
Aria Aber ist in Deutschland geboren, lebt und arbeitet aber seit einigen Jahren in Los Angeles. Zuerst erschienen ist "Good Girl" auf Englisch und landete sogar auf der Shortlist des britischen Women's Prize for Fiction 2025. Die deutsche Ausgabe folgte erst später - übersetzt von der Autorin selbst.
Abers Erstlingsroman ist viel mehr als eine Party-Story. Die Autorin lässt auf wildeste Club-Szenen ruhigere Kapitel folgen, in denen die Zerrissenheit der Hauptfigur und ihr Hadern mit den Umständen beleuchtet werden. Auf jedes High folgt eben auch immer ein Kater.
Es geht nicht nur um "MDMA, Speed und ungefähr tausend Zigaretten", sondern eben auch um das Aufwachsen als junge Deutsch-Afghanin in Berlin. Es geht um Freundschaft und Verliebtsein, um Familie und Karriere und um die immerwährende Gefahr von Rechts, die Menschen wie Nila tagtäglich begleitet. Durch diesen Wechsel von Kapiteln voller Hedonismus, Sex und Selbstzerstörung und den eher stilleren Tönen entwickelt Abers Roman einen Sog, der ihn zum echten Page-Turner macht.
Die eine oder andere Drogen-Szene weniger hätte es vielleicht auch getan. Denn auf fast 400 Seiten Länge offenbart sich, dass ständiges Lines-Ziehen und Pillen-Schmeißen vor allem eins ist: ziemlich langweilig. Und so wirken die Beschreibungen des ständigen Konsums mit der Dauer etwas ermüdend.
Das ist allerdings nur ein kleiner Wermutstropfen, der nicht über die Wucht dieses Romans hinwegtäuschen kann. Ein Roman, der sich anfühlt wie ein einziger süchtig machender Trip.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke